‚You’d better keep your plans top secret‘, (fortune cookie)
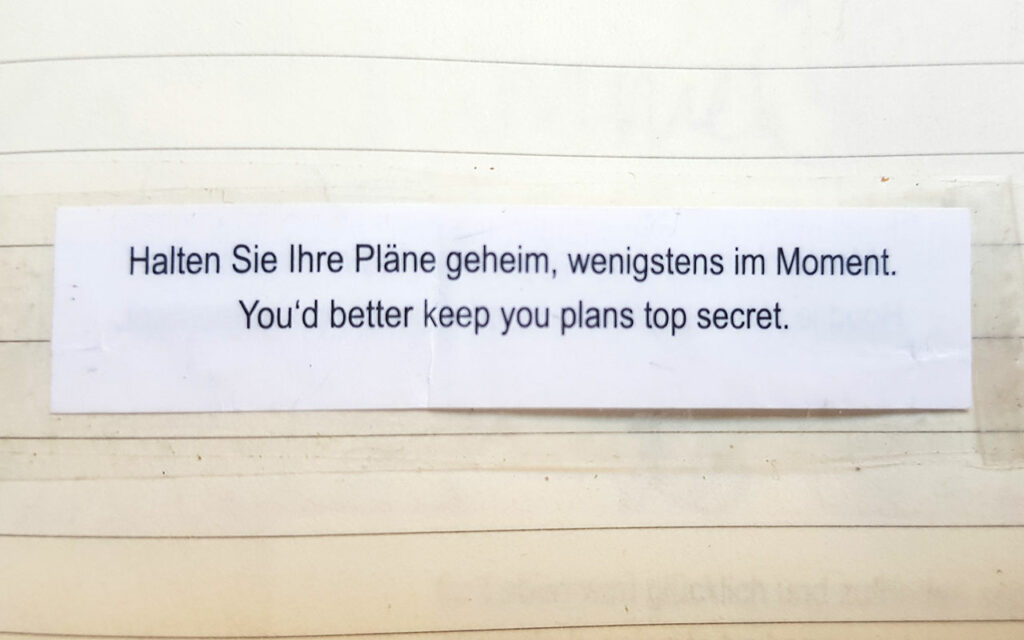
Da, wo ich bin,
werden die Speisen von Lippenblütlern auf Handtellern serviert.
Da, wo ich bin,
huschen Wesen mit fliegenden Tapetenschössen von Raum zu Raum.
Da, wo ich bin,
haben die Blätter vom letzten Herbst in den Winkeln der Stadt Schlupf gefunden.
Da, wo ich bin,
breitet in der Furt der Häuser ein Efeuengel seine Flügel aus.
Da, wo ich bin,
vertäuen Wäscheleinen die Häuser, eins mit dem anderen. In einem Drahtseilakt wird das Innere nach außen gekehrt, bewimpeln Intimitäten die Stadt. Die Bloslegungen des Privaten erzeugen eine genierliche Vertrautheit, die Häutungen flattern an der Leine, aufgeschenkelt an Wäscheklammern. Vielleicht brauchen die Menschen,
da, wo ich bin,
keine Kleiderschränke, weil permanent alles gewaschen wird, in zwanghafter Anmutung gereinigt, entstäubt, an den Drähten über dem Abgrund schwebt, entschwebt, aus dem Wollkleid wird ein Wolkenkleid, während sich der Frotteemantel vor dem Balkon im dritten Stock gegenüber vor wenigen Tagen suizidär zeigte, kopfüber hing, seine Ärmel in der Luftleere keinen Halt fanden und der sich also in der letzten Nacht hat von der Leine fallen lassen. Wer wird ihn bergen und was wird ihm dann geschehen – wie bestattet man einem Bademantel, der sich vom Wäscheseil gestürzt hat,
da, wo ich bin
herrscht allgegenwärtig Sturzgefahr: Auf den Balkonen ohne Brüstungen, den Rampen und den Betonvorsprüngen – das sind die Plateaus, auf denen sich nachts die Fallsüchtigen und Nachtwandelnden versammeln. Monde von roten Slips steigen von der Leine gen Himmel und berauschen das Firmament,
da, wo ich bin,
ist das Leben ein Balanceakt auf dem Grat von Abbruchkanten, die äußere Umgebung, Architektur der Stadt, in Akzeptanz des Nichtzubewältigenden. Der Lawinensuchtrupp tarnt sich als Müllmänner und birgt die zivilisatorischen Überreste aus den Verschüttungen. Versteinerungen auch in den Gesichtern der Lebenden, die immer auch Überlebende sind, wenn sie einfahren in die Schächte der Stadt. Sich ungedrosselt mit Weltuntergangs Rasaunen in den Abgrund stürzende Rolltreppen befördern die Menschen in der gefühlten Unendlichkeit von 2 Minuten 12 Sekunden und 79 Millisekunden auf die Plattformen im Untergrund. Über Tage wird die Freiheit gefeiert.
Dahin, wo ich bin,
führte mich die Expedition ‚Reisen ans Ende der Welt‘ (Ibn Battuta) in 21 Tagen zu meiner inneren Landschaft.
Da, wo ich bin,
krieche ich mit der Stirnlampe, drittes Auge, unters Sofa um hinabzusteigen unter Tage in die Karstlandschaft der Wortsteinhöhlen, schürfe mit den Zähnen an den Ablagerungen meiner Gedanken und Vorstellungen, bohre Worte, hebe Sprache, Goldgenapfe, lasse die Zeiten ineinander übergehen.

Ich versuche mir vorzustellen, was du siehst, wenn du hier durchs Viertel gehst, sagt der Mann hinter Theke des Bistros,
da, wo ich bin,
sehe ich eine Stadt, die in die Knie geht, soweit es die Dehnungsfähigkeit des Materials erlaubt – dieses Nachgeben, das in sich Zusammensacken, dieses Abschmelzen des Betons, die freigelegte Sicht auf die fragile Konstruktion unter der armierten Epidermis. Ich sehe, den Schutt und Staub im Zeitlupentempo implodierender Gebäude, die Verwehungen. Der Tüllschleier, der sich mit operettenhafter Geste über die Mauerstrünke und Rumpfstücke legt, die Rudimente, an denen die Plaketten an die Geistesgrößen erinnern, ‚Wir waren alle Dichter‘.
Diese Verwehungen, die vermorschten Türzargen und die Wunden an den Fassaden, die den Blick ins Innere der Häuser ziehen, die Mörtelspuren, das Narbengeflecht, geplaquet, aufgerieben, roh. Die ganze Prothetik, alles verschnürt, fixiert, arretiert, mit Beschlägen versehen und dupliziert im Schattenwurf. Dieses grob zusammengefügte Leben, die erstarrten Schaumkronen, Polyethuran-Phantasmagorien, die aus den Fugen und Ritzen quillen. Der Stadt,
da, wo ich bin,
läuft seit Tagen das Wehwasser aus den Augenwinkeln, die Regenrinnen speien Wasser, Strudelbäche umwirbeln, umschmeicheln die Fußknöchel, die Schuhe setzen noch während des Einkaufens Moos an, in den Flussadern fließt es lehmbraun, ein ständiger Aufruhr, ich habe das Wassre noch nie blau gesehen oder transparent oder als spiegelnde Fläche oder Selbsterkenntnis vorgaukelnd. Es ist eine Brühe, Broth und die ganze Brut, Brood, hat sich verzogen. Die Stadt der Hunde – nicht mehr auszumachen, ob Mensch oder Tier die überhand hat. Die Stadt ist auf den Hund gekommen, hat ein berühmter Schriftsteller die Redewendung auf ihren Ursprung zurückgeführt, in seinem Epos zu diesem Ort aus Eisen und Beton,
da, wo ich bin,
hat meine Nachbarin vom Eingang rechts zwei Paar Einlegesohlen aufgeleint – Da geht ein Mensch auf dem Zahnfleisch, denke ich.
Da, wo ich bin,
finde ich halt an den Ungereimtheiten meiner Wohnung- dem Küstensaum der an der Sockelleiste aufschlagenden Tapete, den Abschabungen, Stolperfallen, dem abgeplatzten Laminat, den Schleifspuren, Realitätsrissen und Laufmaschinen auf dem Verdeck der Wohnlichkeit.

Die tiefe Fensterbrüstung, deren breites Holzsims ich als morgendliche Lese- und Schreibbank nutze, das Urkissen im Rücken, der Stoffbezug mürbe und ausgebleicht wie welke Haut, das Milchhäutchen auf dem abgestandenen Kaffee, das Kissen ist nicht zu reinigen, es würde zerfallen und mit ihm die gespeicherte Zeit, die Ablagerungen, Hautschuppen, Lebendpartikel aller, die sich im letzten Jahrhundert daran gelehnt haben, deren Tränen darin versiegt sind, die ihr Gesicht darin verborgen, es im Schlaf unter die Achselhöhle oder zwischen die Beine geklemmt, vielleicht sogar ihre Füße darauf abgelegt und sich an seinem Bezug den Schweiß von den Handflächen gerieben haben- all diese zu Hornhaut und Flechten gewordenen Körperzustände bleiben für immer in ihm geborgen. Eine Hand hat es versäumt, es ist schwer, gefüllt mit Tausenden von winzigen Federchen, einem Schwarm von Fuchsschwänzen – wenn ich mich also auf dem Alkoven eingerichtet habe, dann ziehe ich den Brautschleier, der an einer zerfaserten Hanfschnur als Vorhang dient und am oberen Saum ein faustgroßes Wundmal trägt, da wo sich ein eifersüchtiger Gedanke im Spitzenstoff verfangen und ein Loch gerissen hat. Ich verberge die Schmach im Faltenwurf und bringe mich in meinem Fensterversteck in Position,
da, wo ich bin.
p.s: Ich habe, sagte der Mann, hinter der Theke des Bistros,
da, wo ich bin,
einige europäische Länder besucht. Aber ich konnte keine Verbindung zu euch herstellen. Ich habe euch nicht gefühlt.
p.s.II
Da, wo ich bin,
hängt meine Nachbarin eine Tüte mit Aprikosen an die Wäscheleine zwischen drei Krähenmäntel, die Nachtwache halten über der Stadt,
da, wo ich bin.

‚Moment der Unverfügbarkeit‘ wird gefördert im Programm ‚Offene Entwicklungsvorhaben‘ der VGBildkunst

